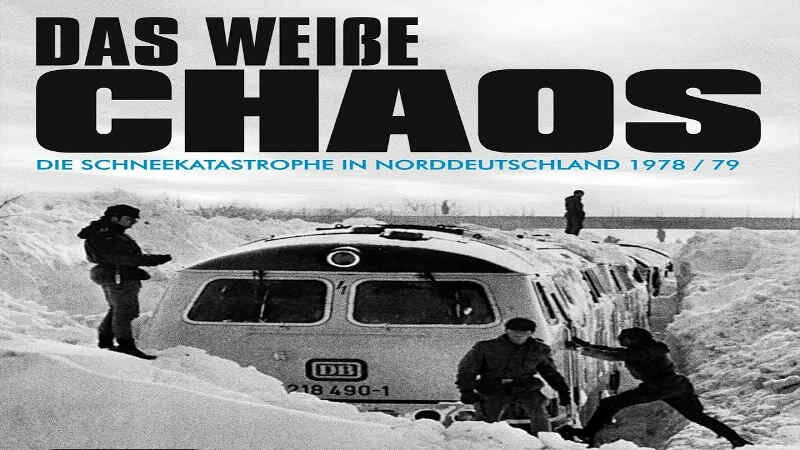Heute mal ein Beitrag über eine Erinnerung, denn in gut zwei Wochen jährt sich ein Ereignis, welches ich nie vergessen werde. Eines, das zeigt, wie unterschiedlich die Winter in Norddeutschland doch ausfallen können – und wie wichtig eine gewisse Vorsorge ist. Das Ereignis fand vor vierzig Jahren statt und ist allgemein als die “Schneekatastrophe in Norddeutschland 1978/79” bekannt geworden.
Ich wohnte seinerzeit noch am nördlichen Harzrand, genauer gesagt in Lutter am Barenberge, und war gerade mal zwanzig Jahre jung. Mein Job im Labor einer Zuckerfabrik war aufgrund des Kampagnenendes am 24.12.1978 beendet worden und mein nächster Job im Labor eines Druckplattenherstellers würde erst am 01.02.1979 beginnen. Zur Arbeit musste ich daher nicht.
Was passierte? Zunächst sah alles ganz normal aus. Es handelte sich um so einen typischen Regen-Matschwetter-Winter. Ich bewohnte das Haus zusammen mit meiner 72-jährigen Großmutter allein, denn der Rest der Familie war zum Besuch von Bekannten nach Büsum gefahren.
Das Haus: Uralt mit Stallgebäude für das Viehzeug und das Heizmaterial (nämlich Holz und Kohle), mit Vorratskeller und einer großen, antiken Waschküche, wie sie damals angesichts der traditionellen Hausschlachtungen noch üblich war. Besagte Waschküche beinhaltete auch einen großen Kessel von 1,5m Durchmesser, der bei den Schlachtungen und für die Wäsche benötigt wurde. Ich hatte mein Zimmer im Erdgeschoss; meine Großmutter wohnte im Obergeschoss. Von Süden her zog eine Warmfront mit feuchtigkeitsgeschwängerter Mittelmeer-Luft rein. Über die Ostsee kam allerdings zeitgleich Polarluft aus Russland. Über Norddeutschland trafen sich beide Luftmassen.
Drei Tage nach Weihnachten, irgendwann nachmittags, begann es zu schneien – dichte, dicke Flocken. Dazu kam der Sturm. Es hörte nicht mehr auf zu schneien. Abends ging ich zu Bett. Am nächsten Morgen war der Strom ausgefallen. Nichts weltbewegendes, denn Stromausfälle kannten wir bei uns auf dem Dorf ja zur Genüge. Deswegen existierte auch immer ein ansehnlicher Vorrat von Kerzen und Streichhölzern. Aber etwas war anders. Es wurde in meinem Zimmer nämlich nicht hell. Konnte es auch nicht, denn die Schneedecke hatte die Fensterhöhe überschritten. Ich stand auf und begab mich ins Bad. Das Wasser lief nicht richtig.
Anschließend sah ich nach meiner Großmutter. Auch die stand gerade auf. Aus ihrem Fenster schaute ich nach draußen. Was ich sah war weiß. Nur noch weiß. Kein Bürgersteig, keine Straße mehr, dafür teils meterhohe Schneeverwehungen und eine davon direkt vor der Haustür. Die hatte meine Fenster dicht gemacht. Weiter oben allerdings peitschten gerissene Überlandleitungen funkensprühend wie eine wildgewordene Kobra über das, was mal die Straße gewesen ist. Und ich sah schwarz. Das sah nämlich alles gar nicht gut aus!
Die gerissenen Leitungen in Verbindung mit dem verheerenden Straßenzustand belegten unzweifelhaft, dass der Stromausfall wohl länger andauern würde. Das erklärte auch die tröpfelnden Wasserhähne: Kein Druck, weil Pumpen ohne Strom nun einmal nicht laufen. Das Wasser versiegte dann auch binnen allerkürzester Zeit. Macht nichts: Ersatzweise gab es ja mehr als genug Schnee.
Ob das nur bei uns so aussah? Das batteriebetriebene Transistorradio lieferte auf UKW nur ein Rauschkonzert. Allerdings betrieb ich zu der Zeit noch aktives DXing (also den Kurzwellen-Fernempfang) und mein Empfänger, ein Kenwood R-300, wurde über eine Autobatterie gespeist. Zwei weitere Autobatterien standen noch im Stall. Über Kurzwelle erfuhr ich, dass es wohl überall in Norddeutschland so aussah. Telefonisch – die alten Analoggeräte bezogen ihre Speisespannung ja noch aus dem Postnetz – kontaktierte uns der Rest meiner Familie und teilte mit, dass die eingeschneit waren und folglich auf absehbare Zeit nicht zurück kommen konnten.
Meine Großmutter und ich waren auf uns allein gestellt. Was bedeutete: Schaufeln! Zuerst mal auf dem Hof hinter dem Haus, wo der Schnee “nur” rund einen Meter hoch lag, um den Stall erreichen zu können. Das Viehzeug (Kaninchen, Hühner, Schweine etc.) musste ja versorgt werden: Erst kommt das Vieh, dann kommt der Mensch. Außerdem wurden auf diese Weise das Plumpsklo und der vom Sommer her eingemottete Grill sowie das Heizmaterial im Stall zugänglich. Wir würden das alles noch gut gebrauchen können. Vom Schnee wanderte sehr viel in den großen Kessel in der Waschküche.
Danach den Ofen dafür angeheizt: Das wurde unser Trink- und Brauchwasser. Der Schneesturm pfiff. Es war schweinekalt. Daher wurden auch alle anderen Öfen im Haus befeuert. Richtig warm wurde es trotzdem nicht, denn zu der Zeit verfügten die meisten Fenster nur über eine simple Einfachverglasung.
Ich schleppte ein paar alte Bleche und Kanthölzer von dem ganzen Geraffel, das im Stall rumlag, in die Wohnung: Kanthölzer auf den Boden und die Bleche darüber ergaben einen primitiven Brandschutz. An halbwegs geschützter Stelle im Stalltor fachte ich den Grill an. Da kamen Backsteine drauf. Wenn die richtig heiß waren, dann schleppten wir die mit Kehrschaufeln aus Blech in die Wohnung und legten sie auf die o. e. Bleche. So wurde es wenigstens etwas verschlagen.
Nachdem der Stall wieder zugänglich gemacht und das Viehzeug versorgt worden sowie die Wasser- und Heizmaterialversorgung gesichert waren, ging es daran, den Hauseingang wieder frei zu bekommen: Eine stundenlange, elende Schufterei. Es wurde quasi ein Gang von der Haustür bis zur Straße gegraben (wobei sehr viel Schnee ins Haus gelangte, allein schon beim Öffnen der Tür) und dann auf Straßenniveau weiter bis zum Nachbarhaus. Dort traf man auf den vom Nachbarn geschaufelten Gang usw. Unser Essen lieferten die Vorräte im Keller.
Nach Ablauf von ein paar Tagen erstreckten sich die geschaufelten Gänge durch das ganze Dorf. Alles war wieder zugänglich geworden. Der ortsansässige Schlachter und die Bäckerei machten das Geschäft ihres Lebens. Strom hatten wir allerdings immer noch nicht und das bedeutete, sich jeden Tag um die Wassergewinnung kümmern zu müssen.
Doch wie sah es draußen eigentlich aus? Auf UKW kam später hin und wieder, stark gestört, der NDR rein und berichtete von einer Schneekatastrophe. Ich verfügte über einen uralten Schwarzweiß-Reisefernseher (Röhrengerät), der mit 12V lief. Da UKW wieder mehr schlecht als recht ging, konnte ich die Batterie vom Kennwood ab- und da den Fernseher anklemmen.
Die Tagesschau brachte Horrormeldungen: Wir waren nur einer von vielen abgeschnittenen Orten! So etwas kann man wirklich nur aussitzen, denn auf Hilfe von außerhalb brauchten wir nicht zu hoffen.
Es gab aber dennoch durchaus Kontakte mit der Außenwelt. Zur damaligen Zeit wurde der CB-Funk ganz groß geschrieben. Mit einem regulären, “postalischen” (also legalem und zugelassenem) Gerät ließen sich vielleicht gerade mal so um die 5km überbrücken. Das reichte nicht. Deswegen existierte seinerzeit auch eine große Szene von CB-Funkpiraten. Wir CB-Funkpiraten verfügten immer über zwei Geräte: Eine postalisch-legale Funke zum Vorzeigen bei etwaigen Kontrollen durch den Gilb (so nannte man die Funkmesswagen der Post) und eine zum Funken. Letztere war auf höhere Reichweite getrimmt worden. Bei mir eine Stabo-Handfunke mit stärkerem Endstufentransistor. Wer beim Löten nicht ganz ungeschickt ist konnte so etwas ja schnell selbst erledigen; zumeist mangelte es lediglich an besagten Transistoren.
Die Stabo-Funke lief regulär mit 12V, vertrug kurzzeitig aber auch 21V und dauerhaft 18V. Das alles erhöhte ihre Reichweite beträchtlich. Nun gelangten die beiden restlichen Autobatterien aus dem Stall zum Einsatz. Die in Reihe geschaltet und mit einem selbstgebastelten Spannungsteiler (der zwar säuisch heiß wurde, aber diese Abwärme konnten wir im Haus ja gut gebrauchen) auf 18V runtergeregelt hielten wir den Kontakt mit der Außenwelt und konnten so mühelos 15km, manchmal und je nach Sonnenfleckenaktivität sogar bis hin zu 30km, überbrücken.
Wir waren die “Nachrichtensprecher” im Dorf und keiner fragte danach, ob das legal ist. Damals lernte ich: Es gibt sinnvolle und sinnlose Vorschriften. Die Sinnlosen sind dazu da, übertreten zu werden. Und: Wenn es hart auf hart kommt, dann ist man auf sich selbst gestellt – immer! So langsam gewöhnten wir uns an das Leben ohne Strom.
Die ersten Räum- und Bergepanzer der Bundeswehr trafen nach gut zwei Wochen ein und machten die Straßen wieder passierbar. Kurz darauf schmolz der Schnee und sorgte für massenhafte Überschwemmungen, durch die wir zeitweise auch wieder abgeschnitten waren. Auch denen ist es zu verdanken, dass wir am Ende annähernd vier Wochen lang ohne Strom auskommen mussten. Eine Warmfront vom Mittelmeer und eine Kaltfront aus Russland, die aufeinander treffen: So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Es könnte sich jederzeit wiederholen.
Würde es sich sich heute wiederholen, dann sähe es wahrscheinlich aber doch ganz anders aus als damals. Denn heute ist das Netz der Abhängigkeiten sehr viel dichter geworden und ohne Strom geht gar nichts mehr.
- Wer heizt schon noch mit Holz und Kohle?
- Wer hat noch Vorräte zuhause?
- Wer verfügt überhaupt noch über die Kenntnisse zum Überleben in so einer Situation?
Der Winter 1978/79 war kein Wintermärchen, sondern eher ein Winteralbtraum!